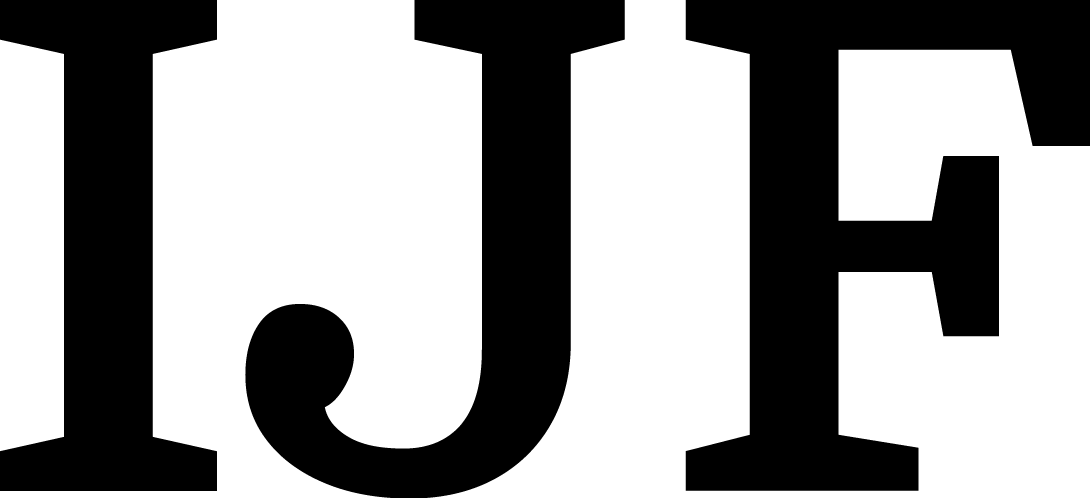Risikoprognose-Instrumente im Strafrecht
Verwendung von Risikoprognose-Instrumenten in forensisch-psychiatrischen Sachverständigengutachten in der Schweiz anhand des Beispiels des Kantons Wallis
Ass.-Prof. Dr. Helen Wyler
Helen Wyler erforscht den Einsatz von Risikoprognose-Instrumenten in Gutachten zu Massnahmen nach Art. 59 und 63 StGB im Wallis (2007–2020).
Das Gericht kann für Personen, welchen eine bei der Tatbegehung relevante, sogenannte schwere psychische Störung attestiert wird, eine therapeutischen Massnahme nach Art. 59 StGB (stationär) oder Art. 63 StGB (ambulant) anordnen. Dies, sofern das Gericht davon ausgeht, dass eine Strafe alleine nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Delikte zu begegnen. Die Massnahmen in ihrer heutigen Form wurden 2007 mit Inkrafttreten der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches eingeführt.
Die Risiko- oder Legalprognose ist ein zentraler Bestandteil massnahmerechtlicher Gutachten und sollte höchsten qualitativen Ansprüchen genügen. Eine zentrale Herausforderung in der Begutachtung ist die Verarbeitung der Fülle von Informationen sowie das Erkennen komplexer Zusammenhänge. Dies kann – ohne entsprechenden Rahmen – die Kapazität selbst erfahrener Expert:innen übersteigen (Rettenberger & Eher, 2016). Risikoprognoseinstrumente können den:die Gutachter:in dabei unterstützen, Informationen in einer strukturierten Art und Weise zu verarbeiten, empirisch fundierte Schlüsse zu ziehen und entsprechend nachvollziehbare Prognosen zu erzeugen. Empirische Studien zeigen, dass strukturierte Legalprognosen, welche validierte Prognoseinstrumente einsetzen, unstrukturierten klinischen Einschätzungen in der Güte der Vorhersage von Rückfällen überlegen sind (z.B. Bengtson & Langström, 2007; Wertz et al., 2022).
Anders als in Deutschland gibt es in der Schweiz für Legalprognosen keine Empfehlungen oder Mindestanforderungen, um die Qualität solcher Gutachten sicherzustellen. Entsprechend stellt sich die Frage, inwiefern verschiedene Risikoprognoseinstrumente bei der Erstellung von Gutachten in der Schweiz zum Einsatz kommen. Ziel dieses Projekts ist daher, die Verwendung von Prognoseinstrumenten in forensisch-psychiatrischen Sachverständigengutachten in der Schweiz anhand einer Vollerhebung aller Verurteilungen nach Art. 59 und Art 63. im Kanton Wallis zwischen 2007 und 2020 zu untersuchen. An diesem Kollaborationsprojekts beteiligt sind der Forensisch-Psychiatrische Dienst der Universität Bern (unter Leitung von Prof. Dr. Michael Liebrenz, zusammen mit Oskar Seifritz, Masterstudent der Medizin), das Amt für Sanktionen und Begleitmassnahmen des Kantons Wallis (unter Leitung von René Duc und in Zusammenarbeit mit LL.M. Melanie Fux) sowie der Universität Luzern (unter Leitung von Ass.-Prof. Dr. Helen Wyler).